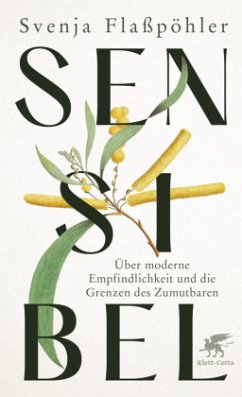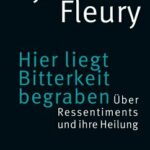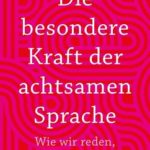Zu starke Empathie kann zu Ich-Verlust führen
Zurücknahme statt Konfrontation, Sensibilität statt Härte, Verstehen statt Abgrenzung. Was wäre gegen solch eine empathische Anteilnahme einzuwenden? Svenja Flasspöhler erklärt: „Bei genauerem Hinsehen jedoch zeigt sich die Gefahr eines regelrechten Perspektivenverlust: Der hier geforderte aufmerksame und einfühlsame Beobachter besitzt überhaupt keine eigne Sicht der Dinge mehr, weil er aufgeht in derjenigen der anderen.“ Friedrich Nietzsche hat sich in seiner Schrift „Jenseits von Gut und Böse“ mit einem solch achtsamen Typus Mensch beschäftigt, der seine Sensoren empfindsam auf die Welt ausrichtet und sein Ich dabei – so zumindest Friedrich Nietzsches These – komplett verliert. Anders gesagt: In dem Begehren, objektiv zu sein, streicht er sich selbst aus. Alles muss wahrgenommen, einfühlsam aufgenommen werden, was, wie Fritz Breithaupt in seinem Buch „Die dunklen Seiten der Empathie“ mit Bezug auf Friedrich Nietzsche formuliert, zu einer „Verdünnung des Menschen“ führt. Svenja Flasspöhler ist promovierte Philosophin und Chefredakteurin des Philosophie Magazins.
Es kann eben auch ein Zuviel an Einfühlung geben
Zudem kommt es zu einer Selbstverneinung, die darin liegt, dass man sich eine eigene Position versagt. „Die Identität besteht mithin darin, keine Identität zu haben“, resümiert Fritz Brauthaupt zum Friedrich Nietzsches Ausführungen. „Der Mensch wird empathiefähig, indem er sein Ich verliert oder ablegt.“ Svenja Flasspöhler ergänzt: „Kurzum: Worauf Breithaut respektive Nietzsche hinweisen, ist die Gefahr, dass es eben auch ein Zuviel an Einfühlung geben kann.“
So sehr ist man beim anderen, bei dessen Sicht der Dinge, dass die Einfühlung letztlich gar keinen Erkenntnisgewinn mehr bringt. Was also tun? Wie angemessen einem anderen Menschen gegenübertreten, der einen guten, freundschaftlichen Rat braucht? Svenja Flasspöhler weiß: „In der Empathieforschung gilt eine „du-zentrierte“ Perspektive gemeinhin als die schwierigere, aber auch ethisch höherwertige.“ Susanne Schmetkamp schreibt: „Bei der du-zentrierten Perspektiveinnahme geht es darum, sich so gut wie möglich die andere Perspektive zu eigen zu machen.“
Ein gewinnendes Gespräch lebt vom Wechselspiel der Perspektiven
Susanne Schmetkamp fährt fort: „Dies setzt eine größere Flexibilität und Sensitivität voraus, aber auch mehr Information und Wissen.“ Sie stellt heraus, dass die Ich-Perspektive als egozentrisch gelte, die Du-Perspektive hingegen als allozentrisch, da wir uns von uns distanzieren müssen. Welchen Erkenntnisgewinn hat ein Rat, der einen Menschen in seinem aktuellen Sein nur bestätigt, weil sich der Ratgebende so weit wie nur möglich in ihn hineinversetzt?
Svenja Flasspöhler stellt fest: „Worum es in einem gelingenden, gewinnbringenden Gespräch unter Freunden doch vielmehr geht, ist ein Wechselspiel der Perspektiven: ein spannungsvolles Hin- und Herspringen zwischen Einfühlung und Herausforderung, zwischen Du- und Ich-Perspektive.“ Anders gesagt: Ist man wirklich an Erkenntnisgewinn und nicht nur an Selbstbestätigung interessiert, dann muss die Grundhaltung empathischer Anteilnahme vom Ratgebenden immer wieder in Richtung Ich-Perspektive überschritten werden, ohne dabei die Du-Perspektive gänzlich zu verlieren. Quelle: „Sensibel“ von Svenja Flasspöhler
Von Hans Klumbies